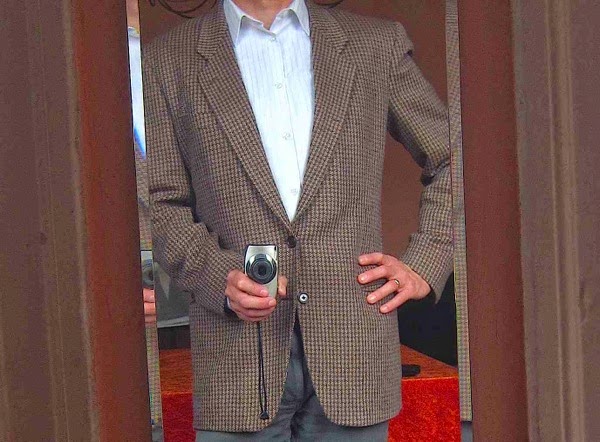Allerhand liegt täglich hier im Viertel auf der Straße herum. Kaugummis, gewisse andere Gummis, Zigarettenschachteln, Kippenstummel, zerknüllte Bierbüchsen. Schnapsleichen, Koksleichen, Ecstasyleichen, echte Leichen. Altpapier, Müllsäcke, Schlüpfer, Handschuhe, Hausschuhe, rahmengenähte Schuhe. Aussortierte, anscheinend noch voll funktionsfähige Toilettenschüsseln. Hundekacke, Möwenkacke, Menschenkacke.
Aber ein vollständig erhaltenes Kugelfischpräparat findet man auch auf dem Kiez nicht alle Tage.
Aber ein vollständig erhaltenes Kugelfischpräparat findet man auch auf dem Kiez nicht alle Tage.
Es lag heute Mittag in stacheliger Pracht vor unserem Nachbarhaus, doch ich hatte leider meine Kamera nicht dabei. Und nachmittags, als ich nach Hause kam, war es leider schon wieder weg, wahrscheinlich blowin’ in the wind.
Abends im Hoheluftstadion hingegen, wo ich mit @ramses101 und @einheitskanzler der Oberligapartie Viktoria Hamburg gegen Germania Schnelsen beiwohnte (3:1), war ich technisch voll ausgerüstet. Deshalb war es mir auch problemlos möglich, das Moma-taugliche Stilleben „Drei Bier in total labberigen Plastikbechern vor Flutlichtmasten“ herzustellen.
Amateurfußball ist übrigens überaus liebenswert, auch wegen der Ansagen. „Wir bedanken uns bei 271 Zuschauern“, sagte der Stadionsprecher. „Die Zuschauerzahl wird wie immer präsentiert von der Tischlerei Lossau. Der Tischlerei Lossau aus Lokstedt.“
Demnächst wollen wir uns noch mal deutlich weiter nach unten orientieren, Richtung siebte, achte Liga oder so – in der Hoffnung auf noch weitaus rührendere Stadionansagen.
Das alles entscheidende 3:1 in der 88. Minute erzielte übrigens Marius Ebbers. Ein paar St.-Pauli-Fans merken jetzt bestimmt interessiert auf und gehen zum nächsten Victoria-Heimspiel.
Und damit hätte dieser Blogeintrag zur Verbesserung der Welt beigtetragen, denn 271 Zuschauer in der Oberliga, das ist ja wohl ein Witz, und zwar ein schlechter.